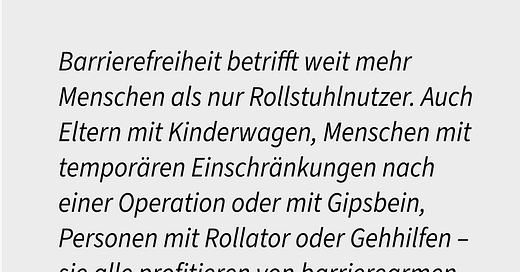Wenn über Barrierefreiheit in der Planung gesprochen wird, denken viele zunächst an den Rollstuhl. Dabei sollte allein schon der Gedanke an einen Menschen, der dauerhaft auf einen Rollstuhl angewiesen ist, Grund genug sein, dieses Thema ernst zu nehmen – sowohl für uns Planende als auch für die Bauherr:innen.
Doch häufig geraten wir bei der Umsetzung barrierefreier Lösungen in Zielkonflikte: breitere Verkehrsflächen, zusätzliche Ausstattung wie Anfahrschutz, automatische Türantriebe oder taktile Leitsysteme – das alles kann zusätzliche Kosten verursachen. In der Praxis stellt sich dann schnell die Frage: Ist das wirtschaftlich machbar?
Was dabei oft übersehen wird: Barrierefreiheit betrifft weit mehr Menschen als nur Rollstuhlnutzer. Auch Eltern mit Kinderwagen, Menschen mit temporären Einschränkungen nach einer Operation oder mit Gipsbein, Personen mit Rollator oder Gehhilfen – sie alle profitieren von barrierearmen Zugängen. Für sie können schon drei Stufen ein echtes Hindernis darstellen.
Bestand vs. Neubau – und die Frage nach der Umsetzbarkeit
Im Bestand ist die Umsetzung gesetzlicher Anforderungen oft eine Herausforderung. Kleine Höhendifferenzen, die technisch kaum vermeidbar sind, führen dazu, dass Rampen nicht zulässig sind, weil sie rechnerisch minimal zu steil wären. Und schon wird auf sie verzichtet – obwohl sie praktisch eine große Hilfe wären.
Hier wünsche ich mir manchmal mehr Spielraum für kreative Lösungen. Doch als Architektin weiß ich auch, dass wir rechtlich an bestimmte Normen und Vorgaben gebunden sind. Und natürlich ist das auch wichtig, um Mindeststandards zu sichern und Willkür zu vermeiden.
Im privaten Wohnungsbau sehe ich deshalb besonders großes Potenzial in der engen Zusammenarbeit von Architekt:innen und Bauherr:innen. Wenn beide Seiten offen sind, Kompromisse zu finden und dabei die Bedürfnisse der Nutzer:innen ernst nehmen, kann Barrierefreiheit auch dort gelingen, wo sie formal nicht zwingend vorgeschrieben ist.
Barrierefreiheit: eine Qualität für alle
Hier ein Überblick über Anforderungen an barrierefreies Bauen im Wohnbereich – ohne Anspruch auf Vollständigkeit und stets im Kontext geltender Landesbauordnungen und DIN-Normen zu prüfen (z. B. DIN 18040-2):
🧭 Allgemeine Anforderungen an Bewegungsflächen:
Barrierefrei:
Bewegungsfläche vor Möbeln: mind. 120 × 120 cm
Türbreiten mind. 80 cm
Rollstuhlgerecht:
Bewegungsfläche zum Wenden: mind. 150 × 150 cm
Verkehrswege: mind. 90 cm breit (Bestand), besser 100–120 cm
Türbreiten mind. 80 cm (Bestand), ideal mind. 90 cm
Zugänge:
Stufenlose Erschließung (z. B. über Rampe oder Aufzug)
Leicht zu öffnende Türen, ggf. Automatiktüren
Schwellen ≤ 2 cm, ideal schwellenlos
🚾 Badezimmer
Barrierefrei:
Bewegungsfläche vor WC, Waschbecken und Dusche: mind. 120 × 120 cm
Bodengleiche Dusche, möglichst mit rutschhemmendem Boden
WC mit fester Sitzhöhe (ca. 46–48 cm)
Haltegriffe vorbereiten oder nachrüstbar (z. B. durch Verstärkung in der Wand)
Türen nach außen oder als Schiebetür geplant
Rollstuhlgerecht (nach DIN 18040-2, Abschnitt R):
Bewegungsfläche vor Sanitärobjekten: mind. 150 × 150 cm
Dusche: 150 × 150 cm, bodengleich, unterfahrbar, Duschsitz vorgesehen
WC seitlich anfahrbar mit Bewegungsflächen: mind. 90 cm auf einer Seite, besser beidseitig
Waschbecken unterfahrbar, Spiegel auch im Sitzen einsehbar
Feste, stabile Haltegriffe am WC und in der Dusche
Türen nach außen oder als Schiebetür geplant
🍳 Küche
Barrierearm:
Bewegungsfläche vor den Arbeitsbereichen: mind. 120 × 120 cm
Arbeitsbereiche gut ausgeleuchtet, mit kontrastreichen Oberflächen
Elektrogeräte (z. B. Backofen) auf Sichthöhe eingebaut
Griffe, Schalter und Armaturen gut erreichbar (85–105 cm Höhe)
Möglichst kurze Wege zwischen Herd, Spüle und Kühlschrank
Rollstuhlgerecht:
Bewegungsfläche zum Wenden: mind. 150 × 150 cm
Arbeitsplatte und Spüle unterfahrbar (mind. 67 cm lichte Höhe, max. 80–85 cm Arbeitshöhe)
Kochfeld mit freien Beinbereich darunter (ggf. Hitzeschutz nötig)
Oberschränke durch Absenkmechanismen oder Auszüge ersetzbar
Steckdosen und Bedienelemente in gut erreichbarer Höhe (85–105 cm)
Ausreichend tiefe Arbeitsfläche (mind. 60 cm) auch bei Unterfahrbarkeit
Geschirrspüler und Kühlschrank bevorzugt mit leicht zu öffnenden Griffen und in geeigneter Höhe eingebaut
🚗 Zugang zum Gebäude:
Wege mit max. 6 % Längsgefälle (kurze Strecken max. 8 %)
Rutschhemmender Belag
Beleuchtung und ggf. kontrastreiche Gestaltung
🛗 Aufzug (wenn vorhanden):
Kabine mind. 110 × 140 cm
Bedienelemente in 85–105 cm Höhe
Visuelle und akustische Anzeigen
Bitte beachten: Die Anforderungen variieren je nach Bundesland, Gebäudekategorie und ob es sich um öffentlich geförderten, privaten oder öffentlich zugänglichen Wohnraum handelt. Im Zweifel gilt: Rechtzeitig mit Fachplaner:innen und Behörden abstimmen.
Fazit
Barrierefreiheit ist keine Sonderlösung – sie ist ein Gewinn für alle. Statt sie als Einschränkung oder Mehrkostenfaktor zu sehen, sollten wir sie als Chance begreifen, Gebäude inklusiver und lebenswerter zu gestalten. Ich wünsche mir, dass wir als Planer:innen mehr Freiraum bekommen, gemeinsam mit den Bauherr:innen pragmatische, kreative Lösungen zu finden – besonders im Bestand, wo Standardlösungen oft nicht passen. Denn echte Barrierefreiheit beginnt mit einem Perspektivwechsel.
Wenn dir gefällt, was du hier liest, freue ich mich, wenn du meinen Blog abonnierst - kostenlos oder mit einem kleinen Beitrag zur Unterstützung meiner Arbeit. So verpasst du keinen neuen Beitrag und hilfst mir, weiterhin mit Herzblut über Architektur, Alltag und alles dazwischen zu schreiben.